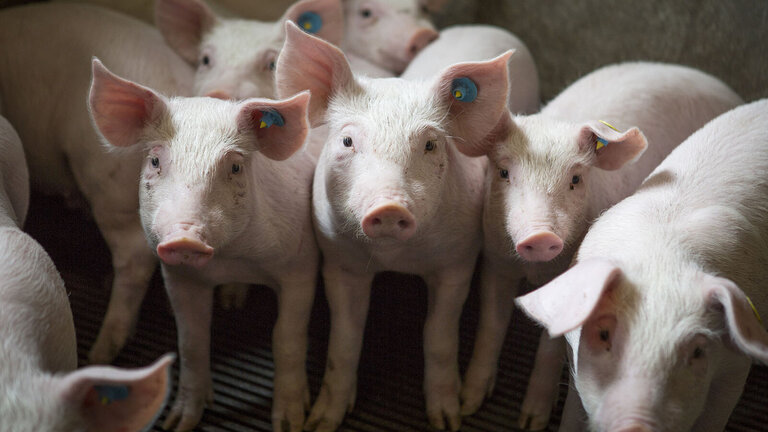Tierfabriken statt BauernhöfeDas sollten Sie über Massentierhaltung wissen
Supermärkte bieten Fleisch, Käse oder Milch in gigantischer Auswahl zum Schnäppchenpreis an. Die Produktion tierischer Lebensmittel für möglichst kleines Geld ist eine reine Industrie und nur durch die Massentierhaltung oder Intensivtierhaltung möglich. Die Zahl der Betriebe nimmt ab, die der Tiere darin steigt. Heute sind 100.000 Legehennen, zehntausende Masthühner oder Puten pro Betrieb eher die Regel als die Ausnahme. Tierfabriken, die 50.000 Schweine beherbergen, sind längst Realität. Einher geht dies mit intensiven, tierwidrigen Haltungssystemen und einer Hochleistungszucht, die die Tiere auf reine Produktionseinheiten reduziert.
Massentierhaltung steigert den Profit
Wenn der Profit für die Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft an erster Stelle steht, geht es ständig darum, die Kosten zu senken. Darum verzichten die Produzent*innen weitgehend auf eingestreute Liege- und Laufflächen und Beschäftigungsmaterial. Sie stellen den Tieren auch keine Strukturen zur Verfügung - wie z.B. Rückzugsmöglichkeiten oder erhöhte Plätze für Hühner und Puten, damit sie ihr Verhalten ausüben können. Vielmehr halten sie ihre Tiere auf engstem Raum in eintönig kargen Hallen. Für unseren „täglichen Bedarf“ drängen sich zigtausend Masthühner und Puten oft in Ställen zum Teil ohne Tageslicht. Zahlreiche Legehennen hocken immer noch in Kleingruppenkäfigen, während viele Milchkühe bis heute ein tristes Dasein fristen und über Monate oder gar dauerhaft angebunden im Stall stehen. Gleichzeitig gibt es immer noch Sauen, die in kleinen Buchten oder sogar Kastenständen ausharren müssen.
So leiden die Tiere in der Intensivtierhaltung
In der engen Umgebung der Massentierhaltung haben die Schweine, Hühner und Rinder meist kein oder kaum Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Die Ställe sind riesige Hallen ohne Rückzugsorte, Futter- oder „Toiletten“bereiche. Dort können die Tiere sich weder so bewegen noch ruhen, fressen, ihre Umgebung erkunden oder mit Artgenossen interagieren, wie sie das wollen. Das führt zu Krankheiten, Stress, Frustrationen und Verhaltensstörungen. Dann kauen viele Tiere an Gitterstangen oder Trögen, rollen mit der Zunge oder verletzten sich gegenseitig.
Begriff: Massentierhaltung oder Intensivtierhaltung?
Oft ist mit „Massentierhaltung“ und „Intensivtierhaltung“ das selbe gemeint. Korrekter ist aber der Begriff Intensivtierhaltung. Denn: Entscheidender als die Anzahl der Tiere ist, wie sie gehalten werden und wie die Landwirt*innen mit ihnen umgehen. So kann auch eine Haltung mit wenigen Tieren schlecht sein - und umgekehrt eine Haltung mit mehr Tieren unter Umständen besser.
Eine Intensivtierhaltung ist geprägt durch industrialisierte Prozesse: zentrale Produktionsstrukturen, Hochleistungszucht und intensive Haltungsbedingungen. Die Tiere leben auf zu engem Raum, werden z.B. durch Amputationen an das Haltungssystem angepasst, ohne Rücksicht auf ihr Verhalten und ihre Bedürfnisse.
Das einzelne Tier zählt nichts mehr
In der Massentierhaltung hat das einzelne Tier kaum mehr einen Wert. Besonders deutlich wird das bei Gesundheitskontrollen.
Es ist einfacher und billiger, verstorbene Tiere irgendwann aus der Haltung zu entfernen, statt sie tierärztlich zu versorgen.
Dies gilt jährlich für Millionen über Millionen sogenannter Falltiere, die aufgrund der Umstände in der Intensivtierhaltung schon vor der Schlachtung sterben. Sie enden als Abfall.
Grausame Praktiken der Massentierhaltung
Damit die Tiere möglichst viel Fleisch, Eier, Milch oder Nachkommen produzieren, werden sie so gezüchtet, dass sie extreme Leistungen erbringen. Dabei überschreiten die Zuchtunternehmen für den Profit die Grenzen dessen, was die Körper der Tiere leisten können. Die dadurch verursachten gesundheitlichen Schäden, Schmerzen und eine verkürzte Lebenszeit werden billigend in Kauf genommen.
Tiere, die sich gegenseitig verletzen, bedeuten für landwirtschaftliche Betriebe Verlust. Anstatt sie artgerechter zu halten, passen die Landwirtinnen und Landwirte die Tiere an. Beispielsweise kürzen sie Puten die Schnäbel, statt ihnen mehr Platz zu bieten.
Kälbern werden die Hornanalagen ausgebrannt bzw. thermisch verödet, um das Verletzungsrisiko für den Menschen und die Rinder untereinander zu reduzieren. Das ist bis zum Alter von sechs Wochen ohne Betäubung zulässig.
Damit Schweine sich in der Enge ihrer Ställe gegenseitig nicht die Schwänze abbeißen, kürzen Landwirtinnen und Landwirte sie ihnen. Dürften die Tiere in einem artgerechteren Umfeld leben, würden sie sich auch nicht gegenseitig verletzen.
Landwirtinnen und Landwirte schleifen Ferkeln die Zähne ohne Betäubung in den ersten Lebenstagen ab, damit sie weder die Sau noch ihre Geschwister beim Kampf um die Zitzen verletzen. Dieser Überlebenskampf entsteht durch die Zucht auf immer größere Würfe. So werden oft mehr Ferkel geboren, als die Sau mit ihren Zitzen versorgen kann.
Die hier genannten Eingriffe sind nur eine Auswahl der grausamen Praktiken. Sie alle bedeuten Schmerzen für die Tiere. Dennoch werden sie ohne Betäubung durchgeführt.
So können Sie den Tieren in der Landwirtschaft helfen
- Bewusster Einkaufen. Machen Sie Artikel wie Fleisch oder Milchprodukte aus Massentierhaltung zu Ladenhütern. Schließlich bietet der Handel nur das an, was die Menschen kaufen. Wenn Sie sichergehen möchten, dass Sie tiergerechter erzeugte Produkte kaufen und keine Produkte aus industriellen Tierhaltungssystemen, halten Sie Ausschau nach dem Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes oder dem NEULAND-Verein für tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung.
Achten Sie auf das Bio-Siegel, insbesondere von biologisch wirtschaftenden Verbänden wie Bioland, demeter oder Naturland sowie vom NEULAND-Verein für tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung. Lassen Sie sich jedoch nicht von Begriffen wie „artgerechte Haltung“ und „Weidemilch“ oder Werbung mit „Tierwohl“ täuschen. Mehr erfahren Sie in unserer Broschüre „Verbraucher*innen haben die Macht“.
- Vegane Ernährung. Eine rein pflanzliche Ernährung ist die tierfreundlichste Lebensweise. Konventionelle Super- und Drogeriemärkte haben mittlerweile ein großes Angebot an pflanzlichen Milch- und Joghurtalternativen, veganen Aufstrichen, Dips und Soßen oder veganen Varianten von Produkten wie Wurst, Fisch, Schnitzel und Käse. Die zahlreichen Fleisch- und Fischalternativen erleichtern den Einstieg in eine pflanzenbasierte Ernährung.
Das fordert der Deutsche Tierschutzbund
Landwirtschaftliche Betriebe müssen Tiere in angemessenen Gruppen halten, anstatt sie in immer größeren Megaställen unterzubringen. Sie brauchen ausreichende Bewegungsmöglichkeiten, Tageslicht sowie eigene Bereiche, in denen sie sich ausruhen, fressen oder koten können. Genauso entscheidend sind ausreichendes natürliches Beschäftigungsmaterial und Strukturen. Zudem brauchen sie Auslauf im Freien. Nur so können die sozial lebenden Tiere ihren Instinkten folgen, gemeinsam ihre Umgebung erkunden, nach Futter stöbern oder sich zurückziehen, wenn ihnen danach ist.
Viele Rechtsvorschriften für die landwirtschaftliche Haltung sind zu lasch. Für einige Tierarten gibt es bis heute nicht einmal gesetzliche Mindeststandards. Obwohl es in Deutschland für alles Regeln gibt, fehlen bisher spezielle Haltungsvorschriften für Rinder, Puten, Schafe und Wassergeflügel wie Enten und Gänsen. Diese konkreten Vorgaben müssen dringend geschaffen werden. Zudem muss der Gesetzgeber weitere Lücken schließen, die durch Ausnahmeregelungen entstehen.
Mehr Tierschutz in den Ställen muss sich auch für die Betriebe lohnen. Wer seinen Tieren mehr Platz, Strukturen, Beschäftigung oder Auslauf bietet, sollte Förderungen des Staates erhalten und durch höhere Verkaufspreise wirtschaftlich profitieren.