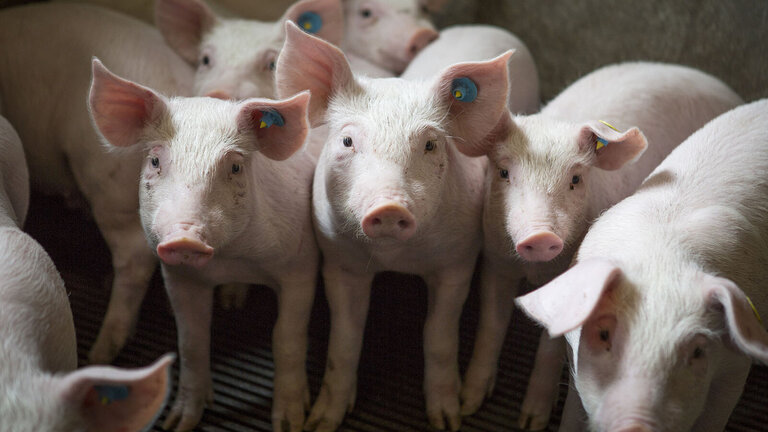Schweine in der LandwirtschaftWie Schweine heutzutage leben
Schweine können bis zu 20 Jahre alt werden. In der Landwirtschaft werden sie in der Regel allerdings schon mit sechs Monaten für ihr Fleisch geschlachtet. Während ihres kurzen Lebens können sie ihren Bedürfnissen nicht nachgehen und müssen in unzumutbaren Umständen ausharren. Die tierschutzwidrige Schweinehaltung in Deutschland muss ein Ende haben.
Schweine wühlen gerne in der Erde, suhlen sich, verbringen viel Zeit mit der Suche nach Nahrung und sind sehr soziale Wesen, die in Gruppen leben. Allerdings ignoriert die Schweineindustrie die natürlichen Verhaltensweisen der intelligenten und reinlichen Tiere. Vielmehr ist sie komplett auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt und extra in verschiedene „Produktionsabschnitte“ unterteilt: die Ferkelerzeugung, die Ferkelaufzucht und die Mast. Jeder Bereich wurde im Sinne des Profits – und auf Kosten der Tiere – optimiert. Die meisten Schweinebetriebe haben sich auf einen dieser Bereiche spezialisiert. Die Bedürfnisse der Schweine bleiben dabei jedoch auf der Strecke.
Spaltenböden führen zu Verletzungen
Aktuell werden hierzulande über 90 Prozent der Schweine „konventionell“ gehalten. Dieses Haltungssystem berücksichtigt die Bedürfnisse der Tiere bei Weitem nicht. Ihrem Naturell entsprechend richten Schweine ihren Kotbereich immer möglichst weit weg von ihrem Schlafnest ein – diese Möglichkeit haben sie in der konventionellen Haltung nicht. Schweine stehen hier auf kargen Betonböden mit Spalten, durch die Kot und Urin hindurchfallen. Auf dem harten, rutschigen und unsicheren Untergrund ohne Einstreu verletzen sich die Tiere häufig ihre Klauen und Beine. Es stinkt zudem nach Urin, die aufsteigenden Ammoniakdämpfe reizen die Augen und Atemwege der sensiblen Tiere. Viele von ihnen leiden auch an Atemwegserkrankungen.
Keine Beschäftigung und kupierte Schwänze
In der konventionellen Haltung haben die Tiere weder Auslauf noch Möglichkeiten, ihren Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. In natürlicher Umgebung nimmt die Nahrungssuche von Schweinen etwa 70 Prozent ihrer Aktivität ein – ansonsten suhlen und wühlen sie gerne. In der industriellen Landwirtschaft gibt es auch kein Material wie etwa Stroh, das zur Beschäftigung und als Futter geeignet wäre. Die Tiere sind auf engstem Raum gefangen und langweilen sich, was Verhaltensstörungen wie „Stangenbeißen“ und „Trauern“ hervorruft – bei Letzterem sitzt das Tier auf seinen Hinterbeinen und lässt den Kopf hängen. Auch Kannibalismus ist möglich. So sind die beweglichen Ringelschwänze der Artgenossen für die Schweine eine Ablenkung vom tristen Leben. Die Tiere knabbern sich gegenseitig daran an, wodurch schlimme Verletzungen entstehen. Um dem vorzubeugen, werden den Tieren die Ringelschwänze bereits in den ersten Lebenstagen amputiert. Die Praxis ist extrem schmerzhaft und erfolgt ohne Betäubung, solange die Ferkel nicht älter als drei Tage sind. Auch nach dem Eingriff bekommen die Tiere keine Schmerzmittel.
Sauen harren im engen Kastenstand aus
Von Natur aus möchten Schweine ihre Ferkel in selbstgebauten Nestern zur Welt bringen – doch dies bleibt ihnen in der intensiven Haltung verwehrt. Dort ist es üblich, siemonatelang in sogenannten Kastenständen zu fixieren. Hierbei handelt es sich um enge Käfige, die verhindern sollen, dass die Sauen ihre Ferkel erdrücken. Die Muttertiere können sich darin kaum bewegen und sich nicht einmal umdrehen. Nur Aufstehen und Liegen ist möglich. Die Sauen sitzen teilnahmslos da oder beißen auf den Gitterstäben herum. Noch bis 2036 bleibt diese Praxis erlaubt, Schuld ist eine gesetzliche Übergangsfrist, die bis dahin gilt.
Immer mehr Ferkel
Die Sauen wurden so gezüchtet, dass sie immer mehr Ferkel bekommen. Dadurch ist die Wurfgröße in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen. Durch die höhere Anzahl an Ferkeln pro Wurf ist massives Leid für die Tiere vorprogrammiert. Viele von ihnen wiegen bei der Geburt zu wenig, sind zu schwach zum Saugen und erkranken. Die Halter*innen betreuen diese Ferkel aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Die Tiere verenden entweder qualvoll oder werden getötet. Nicht selten kommt es dabei zu fehlerhafter Betäubung und Tötung, sodass die Leiden und Schmerzen der Tiere länger andauern.
Außerdem schleifen die Betriebe die Eckzähne der überlebenden Ferkel in ihren ersten Lebenstagen routinemäßig ab, damit diese weder die Sau noch sich gegenseitig verletzen, wenn sie um die Zitzen kämpfen. Denn die Anzahl der Ferkel pro Wurf ist mittlerweile oft größer als die Zahl der Zitzen, die eine Sau hat. So kommt es schnell zu Rangordnungskämpfen. Das Abschleifen der Eckzähne ist laut Tierschutzgesetz ohne Betäubung erlaubt. Hierbei wird ein höchst empfindlicher Nervenbereich freigelegt, was zu unvorstellbaren Schmerzen bei den Ferkeln führt.1
Mehr Leistung durch Hormone
In der konventionellen Sauenhaltung erhalten die meisten Zuchtsauen Hormonbehandlungen, um ihre Leistung zu steigern. Sie sollen so pro Jahr immer mehr Ferkel gebären als sie natürlicherweise schaffen. Das Hormon PMSG steht hier besonders in der Kritik, auch wegen seiner tierquälerischen Gewinnung aus dem Blut trächtiger Stuten. PMSG wird zur Arbeitserleichterung eingesetzt, damit die Sauen im Betrieb zur gleichen Zeit ihre Ferkel bekommen. Doch das Hormon kann auch die Anzahl pro Wurf steigern, was zu überzähligen Ferkeln führt und eine höhere Sterblichkeit zur Folge haben kann.
Im Alter von 3-4 Jahren hat eine Zuchtsau „ausgedient“. Sobald ihre Leistung sinkt, ist sie für den Betrieb wertlos und wird geschlachtet. Der Einsatz von Hormonen wie PMSG ist in der ökologischen Schweinehaltung verboten.
Frühe Trennung von der Mutter
Extrem früh – oft nach nur drei Wochen – werden die Ferkel von ihrer Mutter getrennt und kommen bis zum Alter von zehn bis 15 Wochen in den Ferkelaufzuchtstall. Dort werden die Tiere häufig gruppenweise in sogenannten Flatdecks gehalten. Das sind flache, unstrukturierte Buchten mit vollständig gelöchertem Boden ohne Einstreu und Beschäftigungsmaterial. Pro Quadratmeter sind darin vier bis fünf Ferkel untergebracht. Flatdecks können auf bis zu drei Etagen übereinandergestapelt werden, man spricht dann von einer Ferkelbatterie.

Kastration in der ersten Lebenswoche
Männliche Ferkel werden bereits in den ersten sieben Tagen nach ihrer Geburt chirurgisch kastriert. Auf diese Weise wollen Betriebe den sogenannten Ebergeruch vermeiden. Dieser spezielle Geruch könnte nach der Schlachtung beim Erhitzen des Fleisches zu riechen sein. Die Beine des Ferkels werden dafür auseinandergespreizt und fixiert, um die Hoden zu entfernen. Bis Ende 2020 mussten die jungen Tiere die Kastration sogar ohne jegliche Betäubung erleiden. Doch auch unter Betäubung ist der Eingriff mit großer Belastung fürs Tier verbunden und riskant: Mögliche Nachblutungen und Infektionen belasten die Tiergesundheit. Die Ferkel leiden auch noch nach der Prozedur unter großen Schmerzen. Aus Sicht des Tierschutzes wäre es am besten, die Ferkel gar nicht zu kastrieren – also als Eber zu mästen oder wenn nötig, können sie stattdessen eine Impfung gegen den Ebergeruch erhalten.2
Mastschweine mit sechs Monaten im Schlachthof
Tausende Mastschweine leben allein in einer industriellen Anlage, unterteilt in enge Buchten, ohne Auslauf und ohne Zugang zu Tageslicht. Die Buchten sind so klein, dass sich die Tiere darin kaum bewegen und einander nicht ausweichen können. Viele Tiere vegetieren vor sich hin. Ein 80 Kilogramm schweres Schwein muss auf einem dreiviertel Quadratmeter leben. Je größer und schwerer die Tiere während der Mast werden, desto weniger Platz haben sie. Das Futter für die Mastschweine enthält viel Energie, damit sie innerhalb kürzester Zeit schnell wachsen und viel zunehmen. Schon nach einem halben Jahr wiegen die Tiere rund 120 Kilogramm. In diesem jungen Alter werden sie dann geschlachtet. Das drastische Wachstum überlastet ihren Körper und führt zu Erkrankungen der Knochen und Gelenke. Auch das Herz-Kreislauf-System ist überfordert. Für die Schweine bedeutet das Schmerzen und Stress, wodurch wiederum Magengeschwüre entstehen.
Was ist tiergerechte Schweinehaltung?
Schweine möchten sich draußen im Schlamm suhlen und in natürlichem Boden wühlen. Im Freien können sie außerdem den Platz zum Verrichten ihres Geschäfts weit genug entfernt von ihrem Liegebereich anlegen. All das gehört zu ihren natürlichen Verhaltensweisen. Diese können sie nur in der Freilandhaltung ausleben, was für Schweine am tiergerechtesten ist. Nach einer kurzen Gewöhnung können sie das ganze Jahr über draußen leben – genau wie ihre wild lebenden Artgenossen.
Was Sie tun können
Für das Schnitzel auf dem Teller sterben Tiere: In Deutschland werden jedes Jahr etwa 53 Millionen Schweine für ihr Fleisch getötet. Um dies nicht weiter zu unterstützen, können Sie beim Einkaufen ein Zeichen setzen. Als Verbraucher*in senden Sie mit jedem Kauf ein Signal an Wirtschaft und Politik. Wenn vor allem pflanzliche Zutaten in ihrem Einkaufswagen landen, zeigen Sie, dass Sie die Situation der landwirtschaftlich genutzten Tiere nicht länger hinnehmen. Inzwischen bietet jeder Supermarkt neben Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten zahlreiche weitere vegane Lebensmittel an: Fleischersatzprodukte wie vegane „Schnitzel“, „Würste“ oder „Hackfleisch“ auf pflanzlicher Basis können Ihren Speiseplan mit gewohntem Geschmack ergänzen. Wer dennoch Schweinefleisch kaufen möchte, sollte nur Produkte aussuchen, die mit Labeln wie dem Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes gekennzeichnet sind.
Das fordert der Deutsche Tierschutzbund
Solange Schweine noch für uns Menschen Fleisch liefern müssen, sollen sie ein tiergerechtes Leben führen. Deswegen fordert der Deutsche Tierschutzbund
- Auslauf für alle Schweine
- eingestreute Liegeflächen im Stall
- deutlich mehr Platz im Stall als gesetzlich vorgeschrieben
- verschiedene Bereiche in den Buchten, damit die Schweine an unterschiedlichen Orten ruhen, fressen und koten können
- die komplette Abschaffung von Spaltböden
- geeignetes organisches Beschäftigungsmaterial, zum Beispiel Stroh oder Heu
- keine Fixierung von Sauen im Kastenstand
- Abkehr von der Zucht auf immer größere Würfe
- Abferkelbuchten mit ausreichend Platz und freier Bewegungsmöglichkeit für die Tiere
- Gruppenhaltung für Sauen direkt nach dem Absetzen der Ferkel
- Amputationen (Kastration, Schwanzkupieren) und Abschleifen der Zähne verbieten
- Zucht von robusten Schweinen, die langsam wachsen
- Zucht von Sauen, die sich um ihre Ferkel kümmern können und nicht mehr Junge bekommen, als sie Zitzen haben
- strengere Kontrollen der Tiertransporte
- Überarbeitung der Transportverordnung, insbesondere zu Transportzeiten, Platzangebot, Temperaturen
- Verbot von Tiertransporten, die länger als acht Stunden dauern
- Export-Verbot für lebende Tiere in Länder außerhalb der EU
- anstelle lebender Tiere gefrorenes Fleisch oder Genmaterial transportieren
- strengere Vorschriften zum Schlachten
- Schlachthöfe besser überwachen
Dies wirkt sich auf den Lohn der Landwirtinnen und Landwirte sowie auf die Haltung der Schweine aus.
Quellen und weiterführende Informationen
1 Weitere Informationen über das Abschleifen der Eckzähne bei Ferkeln finden Sie im Tierärzteportal vetline.
2 Weitere Informationen über die chirugische Kastration von Ferkeln und Alternativen finden Sie in unserem Positionspapier.