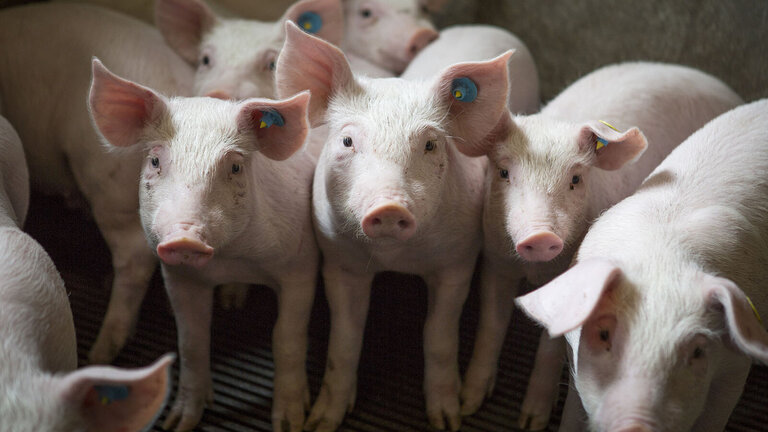Schlachtung trotz Betäubung oft qualvollSo leiden Tiere, wenn wir sie schlachten
Wie und wann Betriebe Hühner, Schweine, Rinder und Co. schlachten dürfen, ist gesetzlich geregelt. Doch die Bestimmungen in Deutschland und in der Europäischen Union sind aus Tierschutzsicht nicht ausreichend. Selbst einige der gängigsten Betäubungsmethoden sind so qualvoll und fehleranfällig, dass sie verboten gehören.
Betäubung beim Schlachten wirkt oft nicht
Wer Geflügel, Schweine, Rinder und Co. schlachten will, muss sie in Deutschland und der EU vorher betäuben. Ohne Betäubung ist dies nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Trotzdem sterben auf hiesigen Schlachthöfen immer wieder Tiere unter unerträglichen Schmerzen und Leiden. Dann nämlich, wenn es dort zu Fehlbetäubungen kommt. Das heißt, dass die Tiere gar nicht, nicht ausreichend tief oder zu kurz betäubt werden. Im schlimmsten Fall bekommen sie die Schlachtung und den Weg dorthin bewusst mit. Die Ursachen für solche Fehlbetäubungen sind vielseitig: Es kann daran liegen, dass die Elektrozangen für die elektrische Durchströmung oder die Bolzenschussgeräte, die durch einen Schuss ins Gehirn betäuben, mangelhaft gewartet werden. Oder dass die Mitarbeiter*innen sie falsch anwenden, weil sie nicht gut genug geschult sind oder unter großem Zeitdruck stehen. Auch die Betäubung von Geflügel im elektrischen Wasserbad stellt ein erhebliches Tierschutzproblem dar. Wenn die Vögel nicht mit dem Kopf in das Wasser eintauchen, werden sie nicht betäubt.
Gasbetäubung vor der Schlachtung löst Panik aus
Manche Betäubungsmethoden, die zum Alltag auf Schlachthöfen gehören, sind aus Tierschutzsicht mit Stress und Leiden verbunden. Dies gilt zum Beispiel für die Kohlendioxidbetäubung. Sobald Schweine dem CO2 ausgesetzt werden, reizt dies ihre Schleimhäute. Jeder Atemzug ist schmerzhaft. Die Tiere schnappen nach Luft und versuchen panisch zu flüchten, bevor sie bewusstlos werden. Bis das der Fall ist, dauert es bei Schweinen quälend lange 20 Sekunden, bei Lachsen sogar bis zu sechs Minuten.
Geflügel erlebt das Schlachten oft bewusst mit
Betriebe, die Geflügel schlachten, betäuben es oft im elektrischen Wasserbad. Dazu hängen sie die Tiere an den Beinen kopfüber in Haltebügel. Das allein ist meistens bereits schmerzhaft. Wenn die Hühner, Hähne, Puten, Enten und Gänse danach automatisch zum Wasserbad transportiert werden, erhalten sie häufig vor der Betäubung schmerzende Stromschläge oder tauchen gar nicht in das Wasser ein, weil sie sich so viel bewegen. Somit entgehen sie dem elektrischen Schock, erleben aber die Schlachtung bewusst mit.
UNZÄHLIGE TRÄCHTIGE TIERE LANDEN AUF SCHLACHTHÖFEN
Nachdem es lange keine gesetzlichen Regeln gab, die Mutter und Fötus geschützt hätten, dürfen Kühe und Sauen seit 2017 nicht mehr zum Schlachthof gebracht werden, wenn sie sich im letzten Drittel der Trächtigkeit befinden. Grundsätzlich ist diese Gesetzesänderung ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber trotzdem bleiben zu viele Ausnahmen erlaubt. So gilt das Gesetz etwa nicht für Schafe und Ziegen. Außerdem können Tiere auch dann noch kurz vor der Geburt geschlachtet werden, wenn Tiermediziner*innen dies anweisen oder eine Tierseuche ausbricht. Für den Fall, dass die Tötung eines hochträchtigen Tieres aus Tierschutzgründen noch vor der Geburt notwendig ist, sollten Tierärztinnen und Tierärzte es immer tierschutzkonform einschläfern. Das erspart der Mutter und dem Ungeborenen zumindest Schmerzen und Leiden.
Die deutsche Schlachtindustrie schlachtet jährlich etwa eine Million Milchkühe.
Das Leid einzelner Tiere geht in der Masse unter
Seit Januar 2013 gibt es in der EU eine einheitliche Schlachtverordnung. Diese Verordnung ist aus Tierschutzperspektive aber unzureichend und nicht eindeutig genug. Dadurch lassen sich einzelne Bestimmungen unterschiedlich auslegen. So kommt es auch, dass sich die Situation in vielen Schlachtbetrieben in den letzten Jahren verbessert hat, während manche immer wieder gegen geltendes Recht verstoßen. Sie kümmern sich bewusst oder unbewusst zu wenig um die Tiere. Weil sie täglich so viele Tiere schlachten, untersuchen die Mitarbeiter*innen zu selten, ob auch wirklich jedes einzelne Tier betäubt ist. Mal übersieht das Personal so etwas, manchmal nimmt es dies aber auch in Kauf. Dabei ist keineswegs sichergestellt, dass die Tiere in kleinen Betrieben besser behandelt werden als in Großanlagen.
Tierqual beim Schlachten stoppenDas fordert der Deutsche Tierschutzbund
Strenge Vorschriften müssen sicherstellen, dass Betriebe Tiere so schmerz- und stressfrei wie möglich schlachten. Damit sie die Bestimmungen einhalten, müssen die Behörden Betriebe besser kontrollieren und das Personal regelmäßig schulen. Die Schlachthöfe sollten auf jedes einzelne Tier Rücksicht nehmen und seinen Zustand überprüfen.
Damit die Schlachter*innen die Tiere schnell, sicher und schmerzfrei betäuben können, sind verbesserte und schonendere Verfahren notwendig. Wissenschaftler*innen forschen beispielsweise bereits zur Betäubung von Schweinen mit Mischungen aus Kohlendioxid, Stickstoff und Argon. Die ersten Untersuchungen belegen, dass die Tiere im Vergleich zu CO2 weniger Stress erleiden und nicht zu fliehen versuchen. Auch die fehleranfällige und qualvolle Betäubung von Geflügel im Wasserbad sollte verboten werden.
Aus Tierschutzsicht brauchen die Veterinärämter mehr Personal, um Schlachthöfe besser und häufiger kontrollieren zu können. Zudem fordert der Deutsche Tierschutzbund eine verpflichtende Videoüberwachung von Schlachtbetrieben. Damit die Behörden die Schlacht- und Betäubungsanlagen sorgfältiger kontrollieren, fordert der Verband seit Jahren einen Tierschutz-TÜV. Dieser könnte durch ein Prüf- und Zulassungssystem verhindern, dass schlecht gewartete oder fehlerhafte Geräte Schmerzen und Leid bei den Tieren verursachen.